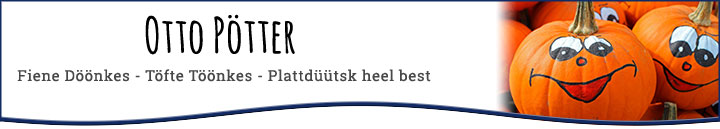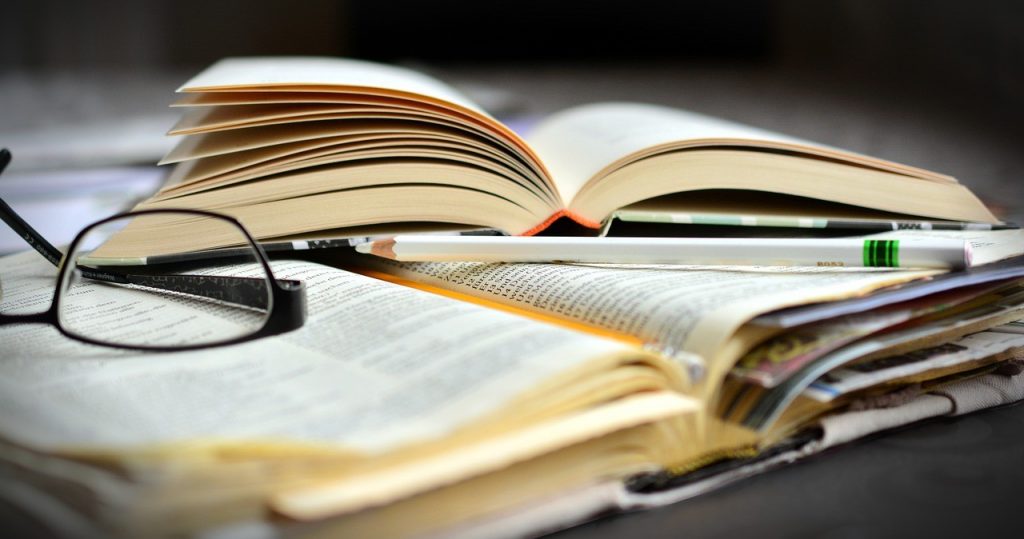Et is all lange Jaohren her, dao wör es maol ne Widdefrau (Witwe). De Kinner wören all graut. Mia aower wör noch in de besten Jaohre un woll nich länger gern alleen mehr sien. Se woll dao wuohl wat an doon, aower so eenfach is dat äs Frau jä nu maol nich.
Män wu dat Glück et woll, leip iähr dao doch es maol ’n ansehnlicken Mann üöwer’n Wech. Dao kreech se nu doch es maol wier lück Löchten bi in de Aogen. Et wör nen grauten Kerl van guet twee Meter. Stabil moss he auk wuohl sien, denn he föhrde säckewiese Veehfuor bi Raiffeisen. Immer wenn he nu drankam, smeet Mia em ’n Aoge to. Doch et schinn, he kreech dao nix van mit.
Verdorri, dat göng nu all Wiäken so. Un de Mann füng un füng nich Füer. Antlest dachte Mia sick: „Wenn et nich änners is, dann gaoh ick de iäben mit nao de Moder Gott’s hen. De sall mi wuohl helpen.“ Un dat dai de guede Widdefrau nu auk. Se woll aower üm Gott’s Willen nich, dat se dao wumüöglick noch mit unner de Lüe kam.
Also leip se immer glieks nao et Meddagiätten in de Kerk, wenn anner Lüe to’n Ünnerst (Mittags-ruhe) de Döppen (Augen) lück tokneepen. Dann stickte se vör de Moder Gott’s ne Kiäße an, göng in de Knei debie liggen un biäddede inbrünstig: „Oh Heilige Maria, ick bitte di, giff mi doch den Grauten. Du Immerwäh’nde Hölpe, giff mi doch den Grauten.“
Dage drup slawienerde stillke den Köster dör de Kerke un kreech van wieden Mia un iähr Flehen gewahr. Dao woll he nu es bi mitmaaken.
Den Dach drup verstoppte he sick achter dat Modergottsbeld un wochtede aff, bis Mia wier kam. Naodem se ’n Kiäßken anstickt harre, smeet se sick auk forts wier vör dat Modergottsbeld daale un biädede: „Oh Heilige Maria, ick bitte di, giff mi doch den Grauten. Du Immerwäh’nde Hölpe, giff mi doch den Grauten.“
„Den kriss aower nich, den kriss aower nich…“, snäbbelde met ne Piepskestimm den Köster trügge. Hä? Wat wör dat denn?! Also nein…
Schwuppdiwupp göng Mia dao nu ratz bi in de Höchte. Ganz kruus keek se up Marias Arm dat Jesuskindken an un schimpte: „Nu haoll du män dienen Bäbbel, du vörluute Blage! Laot leiwer diene Mama to Wort kuemmen, de kann in iähr Öller dao sicher biätter wat up säggen…“